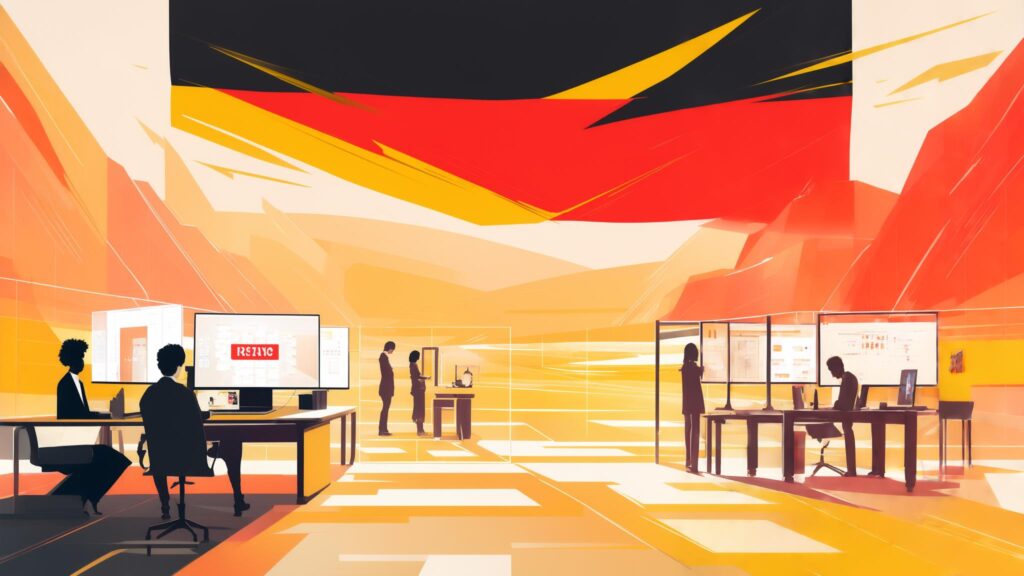
Digitalisierung auf die Nutzer ausrichten
15.10.2025
Während skandinavische und baltische Staaten die digitale Transformation anführen, verläuft sie in Deutschland weiterhin schleppend. Wie eine aktuelle Studie zeigt, gehören mangelnde Nutzereinbindung, Kultur und Führung zu den größten Hindernissen.
Laut dem Digital Economy and Society Index (DESI) liegt Deutschland im Jahr 2025 auf Platz 14 unter den 27 EU-Mitgliedstaaten und damit weit hinter den Spitzenreitern wie Dänemark, Finnland, Niederlande oder Estland. Vor allem in der Verwaltung, im Bildungsbereich und beim Mittelstand verläuft der digitale Fortschritt zäh. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen:
- Regulierungswirrwarr: Komplexe Vorgaben und fehlende Schnittstellen zwischen Bund, Ländern und Kommunen lähmen den E-Government-Ausbau.
- Fehlende Basiskompetenzen: Schulen und Hochschulen hinken bei MINT-Fächern und IT-Ausstattung hinterher. Laut dem ZEW Mannheim fehlen „digitale Grundkompetenzen in allen Lebensphasen“.
- Risikovermeidungskultur: Hierarchische Entscheidungswege, Risikovermeidung und der befürchtete Kontrollverlust über Daten und Geschäftsmodelle bremsen Innovationen aus.
Menschen entscheiden über Erfolg
Zwischen 2022 und 2024 erforschten Wissenschaftler des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) und des OFFIS – Instituts für Informatik Oldenburg den Stand der Digitalisierung in Jobcentern, der kommunalen Verwaltung und Industrie. Bei dieser interdisziplinären Studie arbeiteten Arbeitssoziologie, Informatik und Kommunikationswissenschaften eng zusammen.
In den untersuchten Jobcentern zeigte sich, dass viele digitale Fachverfahren und elektronische Akten bereits etabliert sind. Doch die Systeme scheinen, zu weit vom realen Arbeitsalltag entfernt zu sein. Beschäftigte berichteten von Programmen, die nicht zu ihren Arbeitsabläufen passen und dadurch zu Mehrarbeit führten. Ergänzend untersuchten die Forscher, in einer Fallstudie wie Augmented-Reality-Brillen Beschäftigte in der Industrie bei kritischen Arbeitsschritten bzw. komplexen, verteilten Tätigkeiten unterstützen können.
Die Studienergebnisse zeigen: Digitale Technologien müssen sich an die Bedürfnisse der Nutzer und die Anforderungen ihrer jeweiligen Arbeitsbereiche anpassen und nicht umgekehrt. Damit zeigt sich, dass die Digitalisierung nur dann funktioniert, wenn diejenigen, die täglich damit arbeiten, am Entwicklungsprozess beteiligt werden. Die Beteiligung der Nutzer steigert die Motivation und Akzeptanz und ist gleichzeitig ein Ausdruck von Wertschätzung.
Kultureller Lernprozess
Die aktuelle Studie zeigt: Echtes Vertrauen in digitale Prozesse entsteht nur dann, wenn Beschäftigte, Führungskräfte und Nutzer miteinander kommunizieren, Erfahrungen teilen und gemeinsam gestalten. Digitale Transformation muss als kultureller Lernprozess und somit als Veränderungsprojekt verstanden werden, dessen Motor nicht Algorithmen, sondern soziale Interaktionen sind.
Erfolgreiche Länder bestätigen diese Befunde. Das machen sie anders:
Starke digitale Kompetenzen: Führende Länder investieren konsequent in Aus- und Weiterbildung, so dass ein hoher Anteil der Bevölkerung und der Arbeitskräfte über grundlegende und fortgeschrittene digitale Kompetenzen verfügt. Das erhöht die Nachfrage nach digitalen Diensten und die Bereitschaft, neue Lösungen zu nutzen.
Unternehmensdigitalisierung und Anpassung von KMU: Hoher Digitalisierungsgrad in KMU, die Nutzung von Cloud- und KI-Technologien sowie staatliche Förderprogramme treiben Produktivitätsgewinne. In Deutschland sind Industriefokus und Start-up-Stärken vorhanden, aber die breite Annahme durch KMU bleibt ausbaufähig.
Digitale öffentliche Dienste und Ausrichtung auf die Nutzer:
Spitzenländer bieten umfangreiche, benutzerfreundliche E-Government-Services und setzen auf vorausgefüllte Formulare, Interoperabilität und Unterstützung. Dadurch sinken die Hürden für Bürger und Unternehmen.Politische Kohärenz und gezielte Investitionen: Klare Roadmaps, Förderinstrumente und koordinierte nationale Strategien (Digital Decade Roadmaps) schaffen Planungssicherheit. Die europäischen Spitzenländer koppeln Infrastruktur, Programme zum Erwerb von Kompetenzen und Regulierung.
Neueste Beiträge
- EU-Klimadienst: 2025 drittwärmstes Jahr seit Messbeginn 16. Januar 2026
- Industrie testet KI – strategischer Gesamtblick bleibt aus 18. Dezember 2025
- Pestizide zum Frühstück: Müsli und Mehl mit Chemikalien belastet 9. Dezember 2025
- 2025: Fossile Emissionen mit neuem Rekordhoch 13. November 2025
- Digitalisierung auf die Nutzer ausrichten 15. Oktober 2025
- Umweltpolitik und soziale Gerechtigkeit 5. September 2025
- Plastikabkommen: Verhandlungen erneut gescheitert 15. August 2025
- TV-Werbung: Frauen über 45 unsichtbar 9. Juli 2025
- Frankfurt fährt vorne: Deutschlands fahrradfreundlichste Stadt 23. Juni 2025
- Pestizide: EU verlängert Zulassung ohne Risikoprüfung 16. Juni 2025
